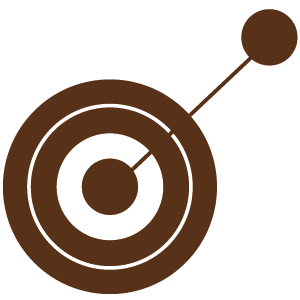Es wird zweifelsohne in Zukunft Arbeitsplätze geben, die der KI zum Opfer fallen. Also wegrationalisiert werden, weil intelligente Automatisierungstools die Arbeit von Menschen übernehmen. Einige Konzerne gehen sogar so weit, KI First Ansätze zu verfolgen, bei denen erst dann ein neuer Mitarbeiter eingestellt werden darf, wenn klar ist, hier kann keine KI eingesetzt werden.
Sichert KI wirklich die Wettbewerbsfähigkeit – gibt es auch Gefahren?
Immer dann, wenn in Routineaufgaben und Prozessen menschliche Interaktion in Form von Kommunikation oder einfachen Handlungen nachgeahmt werden kann, könnte sich die KI zukünftig als vorteilhaft erweisen und den Menschen von seinem Arbeitsplatz verdrängen. Auch wenn KI als Schlüsseltechnologie im digitalen Wandel gilt, sehen viele Unternehmen und auch Beschäftigte ihren Einsatz überaus kritisch.
Vor allem vor dem Hintergrund des Verlustes von Arbeitsplätzen wird immer wieder Kritik laut, die primär auf der Angst von Mitarbeitern basiert. Dabei soll KI den Unternehmen wichtige Wettbewerbsvorteile sichern. Die sind dringend notwendig, denn die globalen Firmen ächzen unter den schwierigen Bedingungen.
Mit einer KI-Strategie können Organisationen in nahezu allen Geschäftsbereichen traditionelle Prozesse in effiziente, automatisierte Abläufe umwandeln. Einerseits soll die KI First Strategie also dafür sorgen, dass Anwendungen und Tools als zentrale Komponente an allen Schnittpunkten in Strukturen zum Einsatz kommen. Andererseits interpretieren einige Global Player die KI First Strategie vollkommen anders.
Wie die Handelszeitung berichtet, muss eine Führungskraft im kanadischen Softwareunternehmen Shopify zunächst beweisen, dass die Aufgaben für eine neu zu besetzende Position nicht von einer KI übernommen werden können. Bei Salesforce werden in diesem Jahr keine neuen Programmierer eingestellt, das hatte CEO Marc Benioff kurz vor dem Jahreswechsel angekündigt. Grund sind Effizienzsteigerungen innerhalb der IT-Abteilung um über 30 % – dank KI.
Ist KI ein Game-Changer für Schweizer Unternehmen?
Im vergangenen Jahr zeigte eine Studie von Colombus Consulting, dass es bei einer Vielzahl von Schweizer Unternehmen zwar grosse Ambitionen für datengestützte Strategien und den Einsatz von KI-Tools gibt. Sie haben aber laut Studie Schwierigkeiten, diese wirkungsvoll in ihre Unternehmensstrategien zu integrieren und umzusetzen. Fakt aber ist, dass gerade Betriebe der Industrie und Produktion mit der Automatisierung bereits alle Möglichkeiten zur Steigerung der Wertschöpfung voll ausgereizt haben.
Von der ETH Zürich gibt es in Zusammenarbeit mit Swissmem und Next Industries ebenfalls eine interessante Studie zum Thema. Die Ergebnisse fallen angesichts des Hypes um KI ernüchternd aus, so die Initiatoren.
Die Studie zeigt, dass KI in der Fertigung aktuell vor allem versuchsweise eingesetzt wird. Viele Unternehmen haben aber ambitionierte Pläne für die nächsten Jahre. Quelle
Künstliche Intelligenz ist die logische Weiterentwicklung der Automatisierung der letzten Jahre. Diese ist nun ans Limit geraten und kann sich den neuen Marktbedingungen nur bedingt anpassen. KI soll diese Probleme nun lösen und den Unternehmen im harten Wettbewerb die wichtigen Vorteile sichern, um langfristig bestehen zu können.
Daten bilden die Grundlage für den Einsatz intelligenter Technologien. Es gibt fertige KI-Anwendungen zu kaufen, man kann eigene KI entwickeln und sich auch zunächst eine aussagefähige Datenbasis inhouse zusammenstellen. Diese lassen sich beispielsweise aus dem Kundendienst mithilfe eines Chatbots generieren und können später ausgewertet werden. Die Studie von Colombus Consulting hat gezeigt, dass die Unternehmen in der Schweiz in diesem Bereich besser aufgestellt sind.
Laut den Ergebnissen sieht die grosse Mehrheit der Unternehmen datengestützte Entscheidungen als entscheidend für die Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. 38 % der Teilnehmer gehen davon aus, dass die Steuerung des Unternehmens zukünftig verstärkt über Daten erfolgt.
KI muss für Gewinne sorgen – und für Wettbewerbsvorteile
Das perfekte Zusammenspiel aller Beteiligten unter Einsatz intelligenter Technologien bringt die höchstmögliche Effizienz in Organisationen. Das bedeutet am Ende auch, die Unternehmen arbeiten effektiv, also wirtschaftlich. Schliesslich müssen sie am Ende Umsatz bzw. Gewinn erwirtschaften. Denn bei den grossen Unternehmen stehen Aktionäre und Aufsichtsräte mit Druck hinter den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen.
Angesichts des anhaltenden KI-Hypes sind die Zahlen aus der Schweiz jedoch tatsächlich ernüchternd, folgen aber auch der Stimmung in anderen Ländern. Eine weitreichende KI-Implementierung ist hierzulande nicht zu erkennen. Dabei kann sie als Werkzeug entscheidend zur Wettbewerbsdifferenzierung und zum Wachstum von Unternehmen beitragen. Auch in der breiten Öffentlichkeit ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz angekommen, und dort zeigt sich in vielen Bereichen Offenheit, die man sich von den Verantwortlichen in den Schweizer Führungsetagen ebenfalls wünschen würde.
Klar ist, dass vor allem Tätigkeiten, die schnell ermüdend sind, häufigen Wiederholungen unterliegen, gefährlich oder belastend sind und gewissen Standards folgen müssen, ideal sind, um sie durch KI zu ersetzen. Doch in der Realität geht (fast) nichts ohne den Menschen, denn der wird gebraucht, um:
- die KI zu entwickeln
- mit der KI zu arbeiten
- von der KI zu lernen
- der KI Dinge beizubringen
- die Analysen in die richtige Richtung zu bringen
- Ergebnisse korrekt zu interpretieren
- Massnahmen abzuleiten und
- Anwendungsgebiete für die KI zu definieren.
In der Zukunft werden Beschäftigte nicht gegen die KI arbeiten oder mit intelligenten Technologien in Wettstreit treten. Vielmehr entstehen wertschöpfende Synergien aus Kooperationen zwischen Beschäftigten, Automatisierungsmethoden und intelligenten Anwendungen.
Schweizer Tech-Unternehmen schöpfen Potenzial nicht aus
Um das Potenzial von KI für Schweizer Unternehmen vollständig auszuschöpfen, hat der Bundesrat im Februar in der Schweiz auch eine umfassende Auslegeordnung in Auftrag gegeben, um Künstliche Intelligenz zu regulieren. Denn mit einem sicheren Regulierungsrahmen entsteht eine rechtliche Basis, um KI nach nationalem Recht und unter Berücksichtigung internationaler Entwicklungen so zu entwickeln, dass mehr Unternehmen ihren Einsatz befürworten und bereit sind, sich für KI-Anwendungen zu öffnen.
Der Bundesrat will KI so regulieren, dass ihr Potenzial für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Schweiz nutzbar gemacht wird. Gleichzeitig sollen Risiken für die Gesellschaft möglichst klein bleiben. Quelle
Dabei sollen die Regulierungen von KI sektorübergreifend erfolgen und dabei auch Aspekte des Datenschutzes berücksichtigt werden. Die Schweiz muss genauso wie Deutschland schnell handeln, um in den Bereichen Forschung, Innovation und Regulierung aufschliessen zu können. Künstliche Intelligenz ist bereits da und es ist nur die Frage, wer sie am effizientesten einsetzt, um sich die begehrten Wettbewerbsvorteile zu sichern.